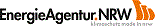

In Zukunft können verschärfte Umweltauflagen und der Trend zu kleineren Energieerzeugungseinheiten die Rahmenbedingungen für den stationären Einsatz der Brennstoffzellentechnologie verbessern. Die Deregulierung der Energiemärkte begünstigt darüber hinaus kleinere Energieerzeugungsanlagen, da der notwendige Kapitalbedarf bei erfolgreicher Markteinführung insgesamt niedriger als bei Großanlagen sein dürfte und damit als Investition in einem stark veränderlichen Markt kalkulierbar wird. Notwendige Voraussetzung für den Brennstoffzelleneinsatz sind faire Rahmenbedingungen für Kraft-Wärme-Kopplung und zur Zeit Regionen mit ausreichender Erdgasversorgung.
Sollte die Liberalisierung des Strommarktes ähnlich wie z.B. in den USA zu einer Minderung der Netzqualität führen, könnten dezentrale Energiesysteme wie die Brennstoffzelle in maßgeschneiderten Einheiten die Stromversorgung sensibler Verbraucher wie Industriebetriebe, Rechenzentren, etc. sichern.
Die Betriebskosten sind dann gerade bei der hohen Energieausnutzung der Brennstoffzelle niedrig. Die Markteinführung im Bereich der stationären Energieerzeugung wird hauptsächlich im Verdrängungswettbewerb zu konventionellen KWK-Systemen wie Gasmotor- und -turbinen-BHKW erfolgen.
Im Bereich der Hausenergieversorgung könnten sich Brennstoffzellen-Heizsysteme mit elektrischer Leistung kleiner 10 kW als Alternative zu konventionellen Heizungsanlagen entwickeln. Sinkende Wärmebedarfe bei Haushalt und Industrie unterstützen Systeme mit hohen Stromkennzahlen, wie eben die Brennstoffzelle.
Ob der Impuls zur Massenherstellung von Brennstoffzellen nun von der Energiewirtschaft oder von den Fahrzeug-Herstellern ausgeht, ist noch nicht absehbar. Hohe Stückzahlen sind in jedem Fall eine wichtige Voraussetzung zur Reduzierung der Investitionskosten von Brennstoffzellen-Anlagen. Für die Automobilindustrie bietet sich aufgrund der Schadstoffarmut und grundsätzlich günstigen technischen Eigenschaften ein zukunftsfähiges Antriebskonzept: Die Anforderungen sind hier im Gegensatz zum stationären Betrieb jedoch aufgrund der geforderten Systempreise und des Systemgewichts ungleich höher.
Generell sind die Erhöhung der Lebensdauer und die Realisierung eines einfachen und robusten Anlagenaufbaus wesentliche Aufgabe der aktuellen Entwicklungsarbeit. Im Bereich der Niedertemperatur-Brennstoffzellen (PEMFC, PAFC) wird weiterhin der Schwerpunkt bei der Brenngasaufbereitung zur Verbesserung des Systemwirkungsgrades und der Reduzierung der Investitionskosten liegen. Die wesentlichen Entwicklungsbemühungen bei den Hochtemperatur-Brennstoffzellen (MCFC, SOFC) werden durch die Arbeit an der Materialverbesserung gekennzeichnet sein.
In der Zukunft ergeben sich für die Brennstoffzelle im stationären Einsatz folgende Chancen:
Der Niedertemperaturwärmemarkt, d.h. der Bereich der Raumwärme- und Warmwasserbereitung ist als das große Einsatzgebiet für Brennstoffzellen in der dezentralen Energieversorgung zu sehen.
Die Perspektiven für die Brennstoffzelle sind vielversprechend. Die technischen Probleme sind vergleichbar mit denen bei Einführung anderer neuer Technologien und erscheinen lösbar.
Kostenziele
Das entscheidende Kriterien für die erfolgreiche Einführung der Brennstoffzelle liegt jedoch weniger im Erreichen technischer Leistungsgrößen und Zuverlässigkeit, als vielmehr anwendungsabhängiger Kostenziele.
Die größte Herausforderung bezüglich der Kosten liegt für PKW- Anwendungen vor. Bei Daimler-Benz wurde 1996 das Ziel 600-700 DM/kW für 2010 gesehen, während Siemens 300-500 DM/kW für machbar hielt. Die Unterschiede hängen nicht zuletzt vom angenommenen Produktionsumfang ab. Bei der von Siemens der Kostenabschätzung zugrunde gelegten Produktionsmenge von 100.000 Einheiten pro Jahr kommt DaimlerChrysler auf einen vergleichbaren Wert von 200-400 DM/kW. Mit etwa 100-110 DM/kW wäre die Technik ebenso teuer wie konventionelle Antriebe. Daher wird dies auch als langfristiges Kostenziel angesehen.
Die zulässigen Investitionskosten für Kraftwerksanlagen sind erheblich höher als im PKW Bereich. Sie betragen je nach Anwendung 1000 bis 2000 DM/kW elektrischer Leistung. Die bereits genannte Forderung an die Standzeit relativiert diesen Vorteil aber wieder.
(Quelle: Energieagentur NRW, Wuppertal)